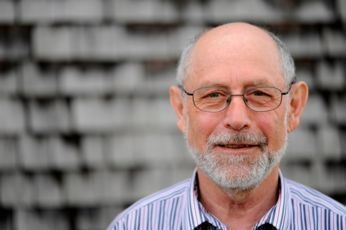Geschichte und Identität – Gastkommentar
Geschichte und Identität
Der Mensch wird von Aristoteles (4. Jh. v. Chr.) als „zoon politikon“, als ein soziales, staatenbildendes Wesen bezeichnet. Mit dieser Idee verbinden sich Fragen, die über das eigene Selbst hinausgehen. Was bedeutet meine Umgebung für mich? Woher komme ich, wer bin ich und wohin werde ich gehen? Wo stehe ich in meinen Beziehungen zur Natur, zum Menschen, zur Pflanzen- und Tierwelt, zum Universum?
Mit diesen urmenschlichen Fragen befassen sich Disziplinen wie die Philosophie, die Theologie, die Psychologie, die Naturwissenschaften. Einen bedeutsamen Faktor auf der Suche nach solchen grundlegenden Antworten stellt auch die Geschichtswissenschaft dar. Sie greift das Begehren nach Erkenntnis über die Hintergründe menschlichen Kommens, Gehens und Vergehens auf und erforscht dieses mittels wissenschaftlicher Kriterien.
Der Begriff Geschichte ist doppeldeutig zu verstehen. Einmal steckt in ihm der Begriff „Geschehen“, im Sinne von „Begebenheit, Ereignis“, das sind die „res gestae“. Geschichte ist also das, was geschehen ist. In zweiter Bedeutung verwenden wir seit dem 15. Jahrhundert das Wort im Sinne der Erforschung des Geschehenen, also die „historia rerum gestarum“.
Daraus lassen sich verschiedene Folgerungen ableiten:
1. Es ist für das Erfassen der Vergangenheit wichtig, das Geschehene in Zusammenhängen zu betrachten. Geschichte ist nicht teilbar, weder regional noch zeitlich. Das heisst, wir müssen die Kontinuität der Geschichte berücksichtigen und zusätzlich auch über die heutigen Landesgrenzen hinausschauen. Dies zieht die Folgerung nach sich, dass es unerlässlich ist, Grundlagen zu schaffen, welche die Erforschung ermöglichen. Ohne Aufarbeitung der Quellengrundlagen gibt es keine Geschichtsforschung.
2. Wir müssen uns der Geschichte, dem Geschehenen stellen. Die Geschichte holt uns ein, ob mit oder ohne unser Zutun. Die Geschichte kann weder vom Individuum noch von der Gesellschaft auf Dauer vernachlässigt werden. Das Geschehene hört nicht auf zu existieren, wenn wir es verdrängen. Es ist besser, sich der Geschichte zu stellen, als von ihr zur Rede gestellt zu werden.
3. Dabei ist zu beachten, nicht nur Teilbereiche unserer Geschichte aufzuarbeiten. Die gesamte Geschichte einer Gesellschaft und eines Staates ist für seine Gegenwart, für das Setzen von Beziehungspunkten und das Schaffen von Vernetzungen von Bedeutung. Deshalb gehören zu unserer Geschichte sowohl die Erkenntnisse aus der archäologischen Forschung als auch diejenigen aus dem Mittelalter und aus der Neuzeit und ebenso die der Gegenwartsgeschichte.
4. Die Erforschung historischer Zusammenhänge ist ein vielschichtiges und langwieriges Unterfangen. Historische Projekte lassen manchmal lange auf sich warten. Diese Projekte eignen sich auch nicht für eine Event-Kultur, sie streben nicht nach Resultaten für den Augenblick. Die Geschichtswissenschaft ist verpflichtet, den gestellten Fragen gründlich nachzugehen und sie kann nicht banausisch nach schnellen Ergebnissen schielen. Geschichtsforschung ist eine auf Langzeitauswirkung ausgerichtete Tätigkeit. Sie macht keinen Spektakel und bietet kein Spektakel. Dieses Streben ist verbunden mit dem Bemühen um Gründlichkeit, Wahrhaftigkeit und Wissenschaftlichkeit.
5. Damit diese Arbeit getan werden kann, braucht es die Unabhängigkeit und Freiheit der Wissenschaft. Diese Wissenschaftsfreiheit zieht allerdings – wie jede Freiheit – auch Verantwortung der Forschenden nach sich. Diese besteht darin, in erster Linie allein ihrem Gewissen folgend – niemandem zuleide und niemanden zuliebe – auf der Basis der Wahrhaftigkeit zu forschen. Dazu gehört, auch unliebsame Ereignisse zu benennen und öffentlich dazu zu stehen.
Die so erforschte Geschichte kann der Gesellschaft helfen, eine eigene Identität mit ihrem soziokulturellen Umfeld aufzubauen. Diese Identität sollte nicht allein aus einem Bezugsstrang bestehen. So wäre es gerade für den Kleinstaat Liechtenstein von entscheidender Bedeutung, nicht nur aus der Herrschaft, sondern auch aus der Landschaft, also aus der Bevölkerung selbst, Identität zu schöpfen. Woher denn sonst, wenn nicht aus seiner Geschichte kann der Kleinstaat Liechtenstein seine Existenz erklären und Antworten auf die Frage finden: Woher kommen wir, was sind wir, wie gestalten wir unsere Zukunft? Eine daraus folgende Stärkung unseres Bürgerstolzes wäre durchaus erstrebenswert. Dabei hat jede Generation ihre eigenen Antworten auf diese Fragen zu finden.
Zu guter Letzt sei darauf verwiesen, dass ein Grundlagenwerk wie das Historische Lexikon des Fürstentums Liechtenstein einen wesentlichen Beitrag bilden kann, um einen identitätsstiftenden Diskurs anzuregen.
Über den Verfasser
Rupert Quaderer ist ehemaliger Forschungsbeauftragter am Liechtenstein-Institut.
Geschichte wozu? Eine Artikelserie des Liechtenstein-Instituts Der Mensch wird von Aristoteles
Mit dieser Beitragsreihe möchte das Liechtenstein-Institut die gesellschaftliche Bedeutung der Geschichte und der Geschichtsforschung in ihren verschiedenen Facetten beleuchten. Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt jeweils bei den Autorinnen und Autoren. Dieser Gastbeitrag erschien im Liechtensteiner Volksblatt vom 19. Dezember 2019.